
Ein Ratgeber rund um Ängste bei Kindern
Die anstehende Impfung, der Gang in den dunklen Keller, das Monster unter dem Bett oder der große Schäferhund vom Nachbarn: Im Alltag von Kindern gibt es immer wieder Dinge und Situationen, die Angst auslösen. Viele Ängste sind typisch für ein bestimmtes Entwicklungsalter und verlieren sich mit der Zeit weitgehend. So spielt die Angst vor Gespenstern mit zwölf Jahren keine Rolle mehr, dafür dann aber vielleicht die Angst vor Mobbing und Ausgrenzung.
Was ist Angst und wie äußert sie sich?
Doch was hat es eigentlich mit der Angst auf sich und hat sie vielleicht auch etwas Gutes? Fangen wir zunächst mit einer Definition an. Angst ist ein Gefühl, sie ist eine von sieben menschlichen Grundemotionen. Die anderen sechs sind Freude, Ekel, Wut, Überraschung, Trauer und Verachtung. Bei Angst fühlen wir uns bedroht, der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt und kann bei Bedarf auf eine Gefahr reagieren – wahlweise durch Flucht, Gegenwehr oder Starre. Das Angstgefühl entsteht in unserem Gehirn im limbischen System. Dieses löst dann körperliche Reaktionen aus wie die Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin oder Cortisol.
Äußerlich merken wir die Angst bei uns selbst oder auch bei unseren Kindern an körperlichen Symptomen wie schnellerem Herzschlag, Gänsehaut, schnellerer Atmung, schwitzigen Händen. Dazu kommen gerade bei Kindern Veränderungen im Verhalten: Sie suchen die Nähe einer vertrauten Person, können nicht einschlafen oder äußern unspezifische Beschwerden wie Bauchweh. Nicht zuletzt können auch Schreien („Iiihhh, eine Spinne!“) oder Wegrennen ein klares Zeichen für Angst sein.
Die gute Nachricht: Die meisten kindlichen Ängste sind nur von kurzer Dauer und wachsen sich aus. Bei Babys und kleinen Kindern ist es oft so, dass sie auf eine sehr konkrete Situation ängstlich reagieren, wie ein lautes Geräusch, das Weggehen der Eltern, den fremden Mann mit Vollbart. In der „magischen Phase“ zwischen etwa drei und sieben Jahren dominieren Ängste vor Monstern, Gespenstern, aber auch vor Gewitter oder Dunkelheit. Wenn Kinder älter werden und Abstraktionsvermögen und Reflexionsfähigkeit entwickeln, treten andere Ängste auf, zum Beispiel vor Ablehnung, Schulversagen, vor Krankheiten und Tod, vor Krieg und Katastrophen.
Altersübliche Ängste im Kindes- und Jugendalter:
- 0 – 6 Monate: laute Geräusche
- 6 – 9 Monate: Fremde
- 9 – 12 Monate: Trennung, Verletzung
- 2. Lebensjahr: eingebildete Figuren, Tod, Einbrecher
- 3. Lebensjahr: Tiere (z.B. Hunde), Alleinsein
- 4. Lebensjahr: Dunkelheit, Monster, Gespenster
- 6 – 12 Jahre: Schule, Verletzung, Krankheit, soziale Situationen, Gewitter
- 13 – 18 Jahre: Verletzung, Krankheit, soziale Situationen, Sexualität

Die Illustrationen für dieses Titelthema kommen von der zehnjährigen Helena, die keine Angst mehr vor Gespenstern hat.
Typische Ängste bei Kindern und was dagegen hilft
Magische Angst: Als magische Phase wird bei Kindern die Zeit vom ungefähr dritten bis zum siebten Lebensjahr bezeichnet. Sie ist geprägt von großer Vorstellungskraft, die Phantasie und Realität vermengt. Der Osterhase, der Weihnachtsmann und die Zahnfee sind für Kinder genauso real wie Hexen, Gespenster und Monster. Und genauso real fühlt sich die Angst davor an. Auch für uns Erwachsene harmlose Gegenstände wie ein Kleiderschrank können durch das magische Denken aus Kindersicht ein Eigenleben entwickeln und gruslig wirken. Die Angst und mögliche Alpträume in dieser magischen Phase können den Schlaf empfindlich stören. Gegen magische Ängste hilft neben Mama- und Papa-Nähe am besten Magie. Mixen Sie gemeinsam ein Anti-Geisterspray aus Wasser, Glitzer und etwas Parfum, das vor dem Schlafengehen im Kinderzimmer versprüht wird. Auch der Aufbau einer Gespensterfalle oder eines Monsterstoppschilds an der Kinderzimmertür können helfen. Oder das Kind sperrt die Monster vor dem Schlafengehen im Kleiderschrank ein und schließt diesen zu.
Trennungsangst: Sie gehört zu den ersten starken Gefühlen eines Kindes und ist eine normale Begleiterscheinung auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Das Kleinkind schwankt dabei zwischen dem Wunsch nach Unabhängigkeit und dem Bedürfnis nach elterlicher Nähe. Trennungsangst tritt erstmals als Fremdeln im zweiten Lebenshalbjahr auf. Das Kind lässt sich jetzt nicht mehr so einfach von Mamas oder Papas Arm an Jemand anderen übergeben. Später kann die Trennungsangst stärker werden und auch in anderen Situationen auftreten, beispielsweise, wenn das Kind abends allein in seinem Bett einschlafen soll oder sich morgens in der Kita von Mama oder Papa trennen soll. Kinder, die unter Trennungsangst leiden, haben Schwierigkeiten, bei Freunden oder den Großeltern zu schlafen. Im Schulalter kann sich Trennungsangst in Form von starkem Heimweh bei Klassenfahrten äußern. In schweren Fällen wollen die Kinder morgens nicht in die Schule gehen. Auslöser oder Verstärker von Trennungsangst können der Tod von Verwandten oder auch vom geliebten Haustier oder ein Umzug sein. Um den Trennungsschmerz nicht größer als nötig zu machen, kann es helfen, Abschiedsszenen kurz zu machen oder Übergangsobjekte wie ein Kuscheltier mitzugeben. Ebenso wichtig ist Verlässlichkeit: Holen Sie das Kind nach Kita oder Schule pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt wieder ab.
Angst vor Katastrophen: Etwa mit dem Vorschulalter beginnt die Angst vor Katastrophen, Unglücken, Kriegen und dem Tod. Auslöser können Berichte in den Nachrichten oder Gespräche in der Schule sein. Selbst wenn ein Krieg oder ein Erdbeben sehr unrealistisch ist, wirkt die Gefahr für das Kind sehr real. Eltern sollten diese Gefahren nicht verharmlosen, sondern dem Kind die aufgeschnappte Nachricht kindgerecht erklären. Altersgerechte Nachrichtensendungen wie Logo können ebenfalls hilfreich sein. Kinder finden oft auch eigene Strategien zum Verarbeiten wie das Malen von Bildern oder Rollenspiele. Verbieten Sie Kriegsspiele daher nicht. Wenn sich das Kind zu sehr in ein solches Katastrophenthema vertieft, kann Ablenkung durch positive Erlebnisse helfen.
Soziale Ängste: Ab der Grundschule und besonders ab der Pubertät treten vermehrt soziale Ängste auf. Dazu gehört zum Beispiel die Angst, von Freunden oder Klassenkameraden ausgrenzt zu werden, sich zu blamieren oder für einen Vortrag vor der Klasse zu sprechen. Von sozialer Angst sind besonders oft zurückhaltende, schüchterne Kinder mit einem geringen Selbstwertgefühl betroffen. Daher kann es helfen, wenn Kinder von früh auf zu Selbstbewusstsein erzogen werden, ihnen immer wieder kleine Erfolgserlebnisse ermöglicht werden und ihnen ihre Stärken vor Augen geführt werden.
Leistungsangst: Sie setzt typischerweise in der Schulzeit ein und umfasst die Angst zu versagen oder kritisiert zu werden, aber auch die Angst vor Klassenarbeiten und Prüfungen. Ein sehr leistungsorientiertes Elternhaus und Druck, möglichst gute Noten nach Hause zu bringen, kann diese Angst auslösen bzw. befördern. Im Gegenzug kann es helfen, den Druck rauszunehmen und Kinder weder für gute Noten zu belohnen noch für schlechte zu bestrafen, sondern ihnen immer wieder die bedingungslose elterliche Liebe zu versichern.

Kurz erklärt: Angst, Phobie oder Panikattacke?
Angst ist ein Gefühl der Bedrohung, das zwar als unangenehm wahrgenommen wird, das aber zur normalen Entwicklung dazugehört. Diese normale Angst hat eine Schutzfunktion und geht meist schnell wieder vorbei. Im Gegensatz dazu gehören Phobien und Panikattacken zu den krankhaften Angststörungen und können dauerhaft die Lebensqualität beeinträchtigen. Die Phobie ist eine dauerhafte, ausgeprägte Angst vor bestimmten Dingen, Tieren oder Situationen, die eigentlich ungefährlich sind. Beispiele sind Höhenangst, Angst vor Spinnen oder Angst vor Spritzen. Wer unter einer Phobie leidet, meidet die Auslöser im Alltag oder versucht davor zu flüchten. Phobien können sich je nach Ausprägung durch Herzrasen, Luftnot oder starkes Schwitzen äußern. Viele Phobien beginnen bereits in der Kindheit oder Jugend. Im Gegensatz zur Phobie hat die Panikattacke selten einen bekannten Auslöser. Die Attacken kommen meist plötzlich und erwartet und gehen mit starken körperlichen Reaktionen wie Herzrasen, Atemnot, Schwindel, Zittern, Übelkeit oder Schweißausbrüchen einher – bis hin zu Todesangst. Daraus kann ein Teufelskreis werden, weil die Betroffenen Angst vor der nächsten Panikattacke haben. Die Attacken können Minuten, aber auch mehrere Stunden dauern und treten oft ohne Vorwarnung auf. Nach einer sehr starken Panikattacke sind die Betroffenen anschließend erschöpft und kraftlos. Wenn Panikattacken häufig auftreten, spricht man von einer Panikstörung, die behandelt werden sollte.
Ursachen von Ängsten
Die Fähigkeit zur Angst ist tief in uns verwurzelt – sie stammt noch aus der Zeit, in der Menschen vor wilden Tieren flüchten mussten, um ihr Überleben zu sichern. Angst und die körperliche Reaktion darauf ist also ein natürlicher Instinkt. Gleichzeit sind viele Ängste „erlernt“. Babys wissen noch nicht, dass es gefährlich ist, sich in einem Obergeschoss zu weit aus dem Fenster zu lehnen oder dass sie sich vor Raubtieren in Acht nehmen sollten. Durch ihre Eltern und ihr Umfeld lernen sie mit der Zeit, was reale Gefahren sind und entwickeln in der Folge Angst vor diesen Situationen. Mit der Zeit kommen auch ungeplante Angsterfahrungen dazu: Wenn ein Kind von einem Hund angesprungen oder gebissen wird, kann daraus Angst vor Hunden entstehen. Oder ein Kind verliert im Gewimmel des Rummels für eine Weile seine Eltern aus den Augen. Das kann zu Trennungsangst führen. Ein Kind, das vom Pferd stürzt, kann Angst vor Pferden oder vor dem Reiten entwickeln. Auch einschneidende Erlebnisse wie der Tod von Verwandten, die Trennung der Eltern oder eine schwere Erkrankung in der Familie können Ängste auslösen.
Die Erziehung durch die Eltern spielt ebenfalls eine Rolle. Zum einen können die Kinder vorgelebte Ängste, wie jene vor Spinnen, übernehmen – selbst, wenn ihnen nie eine Spinne gefährlich geworden ist. Zudem kann stark behütendes, übervorsichtiges Verhalten und strenge Kontrolle zu ängstlichen Kindern führen. Wenn Eltern ihren Kindern verbieten, auf einen Baum oder ein hohes Klettergerüst zu klettern (Mach das lieber nicht, das ist zu gefährlich.) oder allein draußen zu sein (Du könntest entführt werden), nehmen sie ihren Kindern die Chance, Gefahren selbst einzuschätzen und Ängste zu beherrschen. Stattdessen sehen die Kinder überall Gefahren. Zu wenig emotionale Nähe oder fehlende Sensibilität können ängstliches Verhalten ebenfalls begünstigen. Kinder brauchen emotionale Unterstützung und Vertrauen, um sich Dinge zuzutrauen. Auch Drohungen (Sonst kommst du ins Heim. Dann bekommst du vom Weihnachtsmann die Rute.) können Ängste zusätzlich fördern.
Eine Studie hat gezeigt, dass Kinder und Jugendliche mit angeborenem Herzfehler mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Angststörung entwickeln. Generell sind chronische Erkrankungen durch die höhere psychische Belastung ein Risikofaktor für Angststörungen.
Zudem gehen Fachleute von einer möglichen genetischen Veranlagung aus. So sind Eigenschaften wie die Anpassungsfähigkeit an neue Reize, die emotionale Erregbarkeit und die Reaktionsweise des Nervensystems zu einem gewissen Grad angeboren. Angststörungen betreffen daher häufig Kinder, bei denen ein Elternteil vergleichbare Probleme hat.
Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Corona-Pandemie durch die vielen Beschränkungen im öffentlichen und privaten Alltag und die damit verbundene Isolation zu einer Zunahme von psychischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen geführt hat, darunter auch typische Angstsymptome.
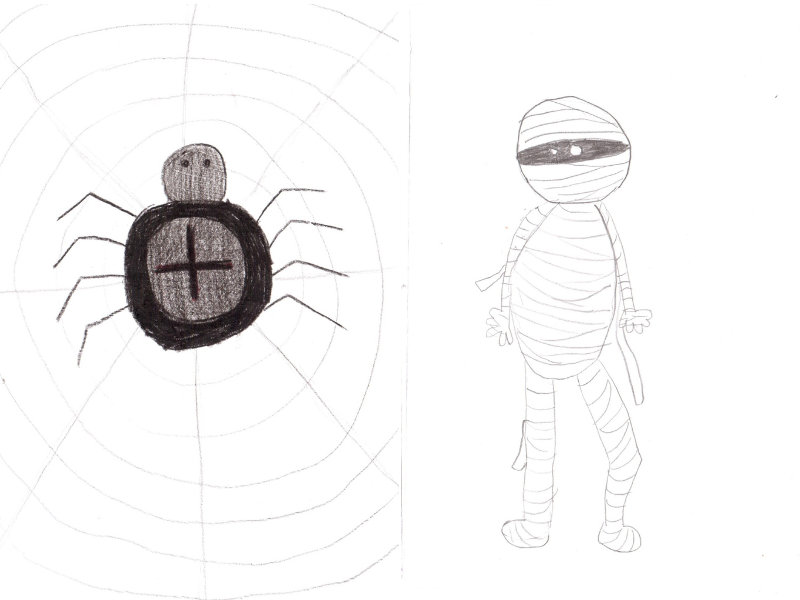
Wann muss Angst ärztlich behandelt werden?
Es kommt also darauf an, ein Kind in seiner Angst zu ermutigen, ohne es zu überfordern. Wenn aber die genannten Maßnahmen und Strategien nicht helfen und ein Kind trotzdem immer wieder Angst vor einer bestimmten Situation hat, dann besteht die Gefahr, dass sich eine normale kindliche Angst zu einer krankhaften Angststörung entwickelt.
Angst ist so lange normal, wie sie vergleichsweise mild ist, nur vorübergehend auftritt und das Kind oder die Familie nicht im Alltag beeinträchtigt. Krankhaft werden Ängste dann, wenn sie mit sehr starken Symptomen einhergehen, über mehrere Monate immer wieder auftreten und die normale kindliche Entwicklung beeinträchtigen und den Alltag der Familie einschränken. Nach einer Erhebung des Robert Koch-Instituts (BELLA-Studie) sind etwa zehn Prozent der Kinder- und Jugendlichen in Deutschland von einer Angststörung betroffen. Damit gehört sie zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in dieser Altersgruppe. Angststörungen gehen häufig mit einer Depression einher. Zusätzlich zu den klassischen Angst-Symptomen können Appetitlosigkeit, Traurigkeit und Gereiztheit auftreten.
Eine solche Angststörung kann sich auf einen konkreten Auslöser beziehen, im Kinderalter ist das am häufigsten Trennungsangst. Die Angststörung kann aber auch sehr unspezifisch sein, so dass die Kinder dauerhaft große Angst haben, aber nicht angeben können, wovor. Betroffene Kinder sind oft angespannt, vermeiden in ihren Augen gefährliche Situationen, sie leiden unter Nervosität, Schmerzen, Übelkeit und Durchfall, Konzentrations- und Schlafstörungen – und generell an ihren Sorgen um die Familie oder die Schule.
Meist bemerken die Betroffenen durch den hohen Leidensdruck selbst, dass etwas nicht stimmt. Manchmal sind es auch die Eltern oder andere enge Bezugspersonen, wie Erzieher oder Lehrerinnen, die auf die Problematik aufmerksam werden. Ganz wichtig: Bei einer krankhaften Angststörung können die oben genannten Strategien kontraproduktiv sein und die Ängste und Symptome sogar noch verschlimmern. Wenn ein Kind Angst vor Wasser hat, kann man es begleitet und schrittweise daran gewöhnen, zunächst mit dem Waschlappen, dann in der Badewanne, später im See oder Meer. Bei einem Kind mit ausgeprägter Angststörung kann der erzwungene Kontakt mit Wasser die Angst noch verschlimmern.
Sobald Sie als Eltern den Verdacht haben, dass Ihr Kind an einer Angststörung leidet, sollten Sie daher ärztlichen Rat einholen. Denn je früher eine Angststörung behandelt wird, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Unbehandelt kann eine Angststörung chronisch werden. Außerdem besteht das Risiko, dass die Erkrankung zu Folgeproblemen führt wie dem Verlust von Freundschaften, sozialer Isolation oder schulischem Leistungsabfall.
Wenn diese Symptome über mehrere Wochen auftreten, ist ein Arztbesuch nötig:
- intensive Ängste und Sorgen mit Nervosität und Konzentrationsproblemen
- motorische Unruhe und innere Anspannung, zum Beispiel Ruhelosigkeit, Zittern, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Muskelverspannungen
- körperliche Übererregung in bestimmten Situationen, zum Beispiel Übelkeit, Schweißausbrüche, Schwindel, Herzrasen, Durchfall, Mundtrockenheit
- starke Trennungsangst des Kindes von den Eltern oder anderen Bezugspersonen
- Schlafstörungen, zum Beispiel unruhiger und schlechter Schlaf, Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme
- psychosomatische Probleme, zum Beispiel häufige Magenschmerzen, Durchfall, Kopf- und Gelenkschmerzen
Erster Anlaufpunkt ist der Kinderarzt, der wird in der Regel an eine Kinder- und Jugendpsychiaterin oder einen Psychotherapeuten überweisen. Nach der Diagnose, die auf Grundlage von Gesprächen, Fragebögen und Tests erfolgt, kann die Behandlung beginnen.
Angststörungen behandeln
Eine Angststörung kann mit verschiedenen Therapien behandelt werden. Bewährt haben sich die kognitive Verhaltenstherapie und die Expositionstherapie. Bei sehr jungen Kindern kann auch die Form einer Spiel- oder Familientherapie geeignet sein. Ziel ist in jedem Fall, dass sich die Kinder ihren Ängsten stellen und sich nicht mehr durch sie einschränken lassen. Sie sollen lernen, die Ängste zu kontrollieren und sich nicht von ihnen kontrollieren zu lassen.
Bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht es darum, sich die eigenen (falschen) Gedanken und Erfahrungen bewusst zu machen und diese negativen Gedankenmuster zu durchbrechen. Wer beispielsweise ein Mal (oder auch mehrmals) von einem Hund angegriffen wurde, hat vielleicht die falsche Annahme, dass alle Hunde gefährlich sind. Durch die Therapie werden solche unrealistischen Gedanken besprochen, kritisch hinterfragt und durch positive, realistische Gedanken ersetzt.
Ergänzt werden kann das durch eine Expositionstherapie, bei der sich das Kind bewusst dem Angstauslöser stellt bzw. sich mit diesem konfrontieren lässt – zunächst im geschützten Rahmen und begleitet vom Therapeuten, später allein. Kinder lernen so, die Angst auszuhalten. Mit der Zeit verschwindet sie dann. Zusätzlich können die Kinder in der Therapie beruhigende Verhaltensweisen erlernen, die ihnen in (künftigen) Angstsituationen helfen, die Angst allein zu bewältigen, zum Beispiel durch spezielle Atemtechniken.
Diese Therapie wird in der Regel von den Krankenkassen bezahlt, wenn eine Angststörung diagnostiziert wurde. Für den optimalen Verlauf der Therapie ist das Mitwirken der Eltern wichtig. Zusätzlich kann bei schweren Angststörungen eine zeitlich begrenzte Medikamentengabe nötig sein. Dabei kommen je nach Art und Schwere der Erkrankung Antidepressiva oder Beruhigungsmittel zum Einsatz. In seltenen Fällen ist eine stationäre oder tagesklinische Behandlung notwendig.
Mehr Informationen & Arztsuche:
www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org








